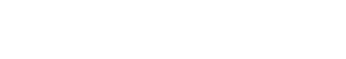- Details
- Veröffentlicht: 06. August 2009
Jeder, der schon einmal auf einen Berg gestiegen ist, kennt das Phänomen, dass man in greifbarer Nähe den Gipfel sieht, sobald man aber dort ist, liegt dahinter ein weiterer Aufstieg. Die Kunst des Bergwanderns ist es also, nicht zu verzweifeln und lieber links und rechts zu blicken, als geradeaus.
Müde und schon ein bisschen lethargisch, ging ich vorbei an einem weiteren kunstvoll geschichteten Berg aus Steinen. Weiter unten sahen sie eher krude aus (ähnlich diesem hier) und in meinem Trott bekam ich die kleinen Änderungen gar nicht mit. Die Konstruktionen wurden immer verspielter und gewagter, als hätte sich jemand zunehmend Mühe gemacht.
Und gerade, als ich nur noch automatisch einen Fuß vor den anderen setzte, kam ich oben an. Hinter mir lag Schnee, dunkle Wolken jagten heran. Und vor mir lag ein grünes Tal. Blumen blühten an den Säumen eines Baches, kleine winterharte Bäumchen wiegten sich hin und her. Die untergehende Sonne glitzerte auf den vom Wind leicht gekräuselten See. Ungläubig drehte ich mich hin, drehte mich zurück, guckte wieder zurück, wieder nach vorne. So einen Kontrast hatte ich noch nie gesehen.
Ich bemerkte, dass links und rechts von mir glatte Felswände hochstiegen, die ein wunderbares wellenförmiges Muster aufwiesen, als wäre der Stein bei seiner Entstehung durch die Jahrzehntausende mal hierhin und dann wieder dorthin gezogen worden. Der Weg hinunter ins Becken des Hochplateaus gestaltete sich äußerst schwierig. Riesige Felsbrocken aus einem eigenartig hellen Stein lagen herum und zwangen mich, der ich ohnehin schon am Ende meiner Kräfte war, zu balancieren, auch zu hüpfen und das mit 25 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken.
Aber es war der warme Wind, der mich trug. Sanft geleitete er mich und wies mir den rechten Pfad. Kaum zu glauben, dass ich gerade noch durch eine Eiswüste gestapft war.
Irgendwann saß ich endlich auf einem weichen Moospolster vor meinem Zelt, der Kocher fauchte vor sich hin und ich konnte noch einmal im letzten Licht meinen Blick schweifen lassen. Keine Zäune, keine Masten, keine Häuser oder sonst ein Zeichen von Zivilisation. Dazu kam, dass es auffallend ruhig war. Nicht einmal Insekten oder Vögel machten sich bemerkbar. Nur Wind, der über Grashalme strich. Noch bevor es ganz dunkel wurde, fiel ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Am nächsten Morgen weckte mich die warme Sonne. Draußen war ein lauer Sommertag. Ein Blick zurück auf den Berggipfel zeigte mir finstere Wolken, die irgendwie festhingen und es nicht über den Gipfel schafften.
Mein Kompass war verschwunden. Dabei hatte ich ihn am vorigen Abend noch benutzt, um ungefähr zu ermitteln, wo ich hin musste. Auch eine intensive Suche brachte ihn nicht hervor. Seltsam. Da es aber ohnehin nur einen sinnvollen Weg gab, nämlich durch das Tal und auf der anderen Seite wieder hoch, war das nicht ganz tragisch.
In Hochstimmung und wieder bei Kräften marschierte ich, vor mich hin singend, weiter. Als ich zum See kam, sah ich, dass das Wasser so klar war, wie man es sich nur denken konnte, selbst in ein paar Metern Tiefe erkannte man noch Fische. Ich kostete von dem kühlen Nass und bemerkte, dass es wunderbar schmeckte.
Neugier trieb mich, zu sehen, wie es denn hinter dem Plateau weiterging. Ob denn da wieder Schnee lag und das hier so etwas wie eine Oase darstellte? Ich entdeckte dann hinter dem See doch einen kleinen Fußweg. Tief lag er eingegraben zwischen Grassoden und Steinen, fast schon zu klein für meine Füße. Es ging ein Stück bergauf und dann wieder zwischen zwei Felswänden hinaus. Und als ich noch ein Stück um die Ecke kam, lag da … Fels. Reiner Fels so weit das Auge blicken konnte. Blanker, heller Fels, ähnlich den Brocken über die ich stolpern musste auf dem Weg hierher. Auf dem Felsmassiv lagen verstreut kleinere Brocken, wie willkürlich verstreute Murmeln.
In zwei Tagen war ich in drei unterschiedlichen Klimazonen gewesen: Schneegletscher, Alpenlandschaft und jetzt Steinwüste. Es wurde heiß, die Sonne brannte auf den Fels, der die Wärme speicherte und wie eine Heizung wieder abgab. Ich wurde müde und weil ich die gestrigen Strapazen noch in den Knochen spürte, schlug ich früh mein Lager auf. Ein Überhang diente mir als Sonnenschutz. Ich schlief ein wenig, kochte, las und genoss die Stille. Nein, um ehrlich zu sein, die Stille machte mir Angst. Ich bemerkte, dass ich unwillkürlich mit mir sprach und immer pfiff oder sang. Wir Menschen scheinen mit totaler Stille nicht gut klar zu kommen. Hier war nicht mal Wind, nur komplette Ruhe.
Als die Sonne sich wieder geneigt zeigte, hinter dem Horizont zur Ruhe zu gehen, wurde es schnell kühler, aber nur wenig dunkler. Kein Mond schien, obwohl der Himmel wolkenlos war. Die Sterne schienen in weiter Ferne. Als die Sonne ganz weg war, sah ich eine Lichterscheinung. Genau über mir strahlte hell ein Kreuz mit gleich langen Strahlen. Ich rief laut aus:
„Was ist das denn?“
„Ein Licht.“
Etwas sprach mit mir. Nicht mit hörbaren Worten, glaube ich, sondern mehr so, dass man das Gefühl hatte, es würde im Ohr direkt entstehen. Im Rückblick ist erstaunlich, dass ich mich überhaupt nicht wunderte, oder erschrak. Vielleicht hatten mich die Stille und meine Selbstgespräche schon so weit gebracht, dass ich das einfach so hinnahm.
„Was für ein Licht?“
„Weiß ich nicht, das kommt manchmal und geht auch wieder.“
„Schön ist es...“
Ich begann zu frieren. Nach und nach zog ich mir alle Kleider an, die ich hatte und wickelte mich in den Schlafsack ein. Noch ein letztes Mal blickte ich nach oben. Das leuchtende Kreuz blieb unverändert.
Heute bereue ich, dass ich mich nicht länger mit der Stimme unterhalten hatte, aber ich wusste wahrscheinlich auch nicht, was ich hätte sagen sollte. Das war, wie wenn man plötzlich mit dem Rockstar seines Herzens backstage bei einem Bier sitzt und nichts anderes heraus bringt als: „Du machst also Musik?“ und er nur stumm nickt.
Kurz bevor ich einschlief wurde ich doch noch gefragt: „Woher kommst Du?“ Ich deutete in die Richtung. „Und wohin gehst Du?“ Ich deutete müde in die andere Richtung. „Viel Glück.“
Ich schlief kaum, denn mir war so eisig kalt, trotz all dem Zeug in das ich mich wickelte, so dass ich froh war, als die Nacht endlich vorbei war. Mit zitternden Fingern machte ich mir einen Tee, während es immer heller wurde. Danach ging es schnellen Schrittes wieder weiter.
Das Felsplateau endete ziemlich abrupt an einer Wand, die ich entlang gehen musste, bis ich eine einsame, uralte Holzleiter fand, an der ich hochkletterte. Ich blickte nicht zurück, dafür nahm ich mir keine Zeit, es ging mir nicht gut. Ich wollte nur weiter, brach dann aber fast zusammen, als ich sah, was vor mir lag: 500 Meter streng nach oben, in fieser Steigung und aalglatt. So viel Energie kann man gar nicht haben, um das locker pfeifend anzugehen. Zumindest nahmen jetzt die Moosflecken und Grasbüschel wieder ein bisschen zu, so dass ich mich manchmal festhalten konnte und den Fuß fest anlegen, aber wenn ich so nachdenke, dann war das das Anstrengendste, das ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe.
Auf halbem Weg zitterten meine Beine, aber ich musste weiter, denn wo sollte ich sonst hin? Nach endlosen Stunden kam ich oben an und konnte nur noch hoffen, dass dahinter nicht noch mehr Steigung auf mich wartete, aber es kam die Erlösung. Vor mir und wieder hinter einem Durchgang zwischen bemusterten Felswänden lag: … Schottland … irgendwie.
Ein schöner, breit getretener Wanderweg, Brücken über Bäche, Schafe und Telefonleitungen und Heidekraut, soweit man blicken konnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich so froh, es geschafft zu haben, dass ich keinen Gedanken daran verschwendete, wo ich gerade herkam. Zudem zogen wieder Wolken auf und es begann streckenweise zu schauern.
Wieder ein paar Kilometer später überholten mich von hinten ein paar Wanderer mit wesentlich leichterem Gepäck. Die Norweger sind zwar sehr nett und gastfreundlich, aber sie haben so eine lautlose Art, sich über die Touristen mit mannshohen Rucksäcken lustig zu machen, einfach nur indem sie freundlich grüßend mit demonstrativ großen, schnellen Schritten vorbeieilen. Bevor sie in einer (gedachten) Staubwolke verschwinden konnten, fragte ich sie, was das nächste Ziel auf dem Weg sei. Sie sagten, da vorne läge eine Herberge, sie wären gerade auf dem Weg dahin. Schön, dachte ich mir, wieder in der Zivilisation, Sachen trocknen lassen, Essen kaufen, hinsetzen ... herrlich! Mit neuer Kraft stolperte ich hinter den Roadrunnern her und erreichte, zwei Stunden nach ihnen, auch schon die Hütte.
Der Herbergsvater begrüßte mich überschwänglich und lachte herzlich über meine Frage, ob denn noch ein Bett frei wäre, denn von den vier Zimmern mit je 20 Betten waren genau 5 belegt. So konnte ich meine Zeltplanen im Zimmer zum Trocknen aufspannen und in die Stube gehen. Der Wirt musste mir zeigen, wie man sich hier wäscht (man nimmt eine Schüssel, geht zum Kachelofen, nimmt sich aus einem Riesentopf heißes Wasser und geht in einen Verschlag, um sich dort mit einem Waschlappen zu reinigen).
Außer mir waren noch zwei Norweger und zwei Engländer hier und der Wirt machte abends dann eine Flasche Wein auf, was eine sehr freundliche Geste war, denn erstens ist Wein in Norwegen eh teuer und obendrein muss hier oben alles mit dem Helikopter eingeflogen werden. Es wurde ein sehr schöner Abend. Einzig meinen Erzählungen konnte keiner folgen, denn alle Anwesenden schworen Stein und Bein, dass der Weg von dem ich kam, direkt vom Berggipfel herunter käme. Von dem Tal und dem Felsplateau hatte noch keiner etwas gehört oder es gesehen. Außerdem hätte es in den letzten drei Tagen pausenlos geregnet.
weiter geht es dann nach Bergen