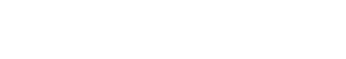- Details
- Veröffentlicht: 05. August 2009
Manchmal weiß man erst Jahre später, dass etwas besonderes geschehen ist. Zuerst sieht man es, hört, riecht und schmeckt es, aber es fehlt das Wissen, wie man das Aufgenommene auswerten soll. Irgendwann hat man dann, vielleicht unbemerkt, eine Entwicklung vollzogen. Und wenn man Glück hat und sich noch erinnert, dann erlangt man die Erkenntnis, dass die Dinge nicht so waren, wie sie schienen.
Vor Jahren war ich in Norwegen. Ein kleiner Wandertrip mit Rucksack und Zelt. Geld hatte ich kaum eins. Es geschah vermeintlich das Folgende: Ich stieg in Oslo in den Zug nach Finse, stapfte von dort durch den Schnee bis zum Berggipfel, dann über immer grüner werdende Wiesen und Felder hinab, schlief in einer Hütte, ging weiter über ein Felsplateau, bis ich wieder auf Zivilisation traf und von dort den Bus nach Bergen nahm. Dort traf ich ein paar Jugendliche aus aller Welt, ging in Museen und shoppen, bevor ich den Zug zurück nach Oslo bestieg. War ein schöner Urlaub.
Aber was wirklich passiert ist, davon will ich hier erzählen.
Ich stand zu dieser Zeit auf einem Scheideweg. Mein Studium schien niemals fertig zu werden, ich hatte auch kaum Lust auf eine Karriere in der eingeschlagenen Richtung, mein Geld war alle, meine Freunde waren mir suspekt (oder vice versa) und eheanbahnungstechnisch befand ich mich noch nicht einmal in einem potentiellen Entwicklungsstadium. So kam es, dass ich eines Tages schon vormittags ein paar Bier trank und anschließend ins Reisebüro für Studenten schlenderte.Es war ein schöner warmer Spätsommertag in Wien, die Kastanien blühten zum zweiten Mal in diesem Jahr, keiner wollte die Stadt verlassen, deshalb waren nur wenige Leute vor mir dran, um genau zu sein, wurde ich sehr schnell von drei gelangweilten Angestellten gleichzeitig bedient. Ich sagte, ich würde gerne weg, sie fragten wohin und ich gab die klassische österreichische Antwort: Wurscht.
Eine Woche später stand ich in Oslo. Es war nicht mehr so warm, aber immer noch sonnig. Die Saison endet in Norwegen im August, weil es ab da beginnt, kalt zu werden. Dementsprechend überrascht waren die Damen in der Touristeninformation, als ich mit Rucksack hereinspaziert kam. Sie grüßten freundlich und ich sagte, ich würde gerne wandern, sie fragten wo und ich sagte: Wurscht.
Glücklicherweise bin ich der Empfehlung der Touri-Informantin gefolgt und habe mir noch schnell Handschuhe gekauft. Denn in Finse war es nicht mehr sonnig und warm. Der Zug war zuerst durch eine herrlich verwilderte Natur gefahren, doch je höher wir kamen, desto spärlicher wurde das Grün und letztendlich stapfte ich durch den Schnee zur Herberge. Der Himmel wolkenverhangen, der See von grauen Schleiern bedeckt. Es war eisig kalt. Meine Stimmung passte sich dem Wetter an und ich begann, mich so richtig mies zu fühlen.
Nach der Nacht im Sammellager unter dem Dach und einem kargen Frühstück sah ich aus dem Fenster und musste feststellen, dass der vorherige Tag kein schlechter, sondern normal war. Ich fasste zusammen: Ein schwerer Rucksack, unzureichende Kleidung und ein untrainierter Körper stehen knöcheltief im Schnee. Der „Wanderweg“ begann hinter den Schienen und führte steil den Berg hinauf, in die Wolken. Ich hatte keine Ahnung, wohin der Trek ging. Die ersten Leidensgenossen stiegen den Weg hinauf, erstaunlich gut gelaunt und besser gerüstet. Ein Stoßseufzer und ich stapfte hinterher, gerade als es zu nieseln anfing. Na super.
Zwei Stunden später war ich durchfroren und nass. Meine Schuhe waren aufgeweicht, meine Schultern taten weh. Der kalte Wind wehte eisigen Schneeregen in mein Gesicht und nahm an Kraft zu. Aber oben auf dem Gipfel sah ich, durch den Nebel hindurch, eine Schutzhütte schimmern. Als ich eintrat, saßen, wie die Hühner auf der Stange, schon mindestens 20 Leute in einem Raum, so groß wie eine Abstellkammer. Die Kleider dampften und es roch … gut! Jemand kochte Kaffee. Draußen begann ein Sturm zu toben, drinnen unterhielten wir uns gleich wie alte Freunde. Es waren Besucher aus Amerika, Italien, Deutschland, Australien, alle gefangen in einer kleinen Hütte, auf halbem Wege nach Wurscht.
Nach einer Stunde war der Sturm vorbei. Wir verabschiedeten uns herzlich voneinander und gingen alle in eigenem Tempo weiter.
Es gab viele Richtungen. Ein Pfad war im Grunde nicht mehr vorhanden. Man konnte sich aber an kunstvoll geschichteten Steintürmen orientieren und sich selbst bei schlechter Sicht immer weiter voran kämpfen. Ich hatte nicht viel Zeit, weil ich einen passablen Zeltplatz finden musste, bevor es dunkel wurde. Auf Schnee zelten wollte ich nicht. Nach einem endlos scheinenden Aufstieg und vielen kleinen Verschnaufpausen später, erreichte ich das Tor zum Zauberland.
Weiter im Zauberland