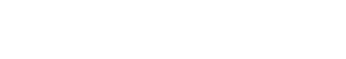- Details
- Veröffentlicht: 18. Juni 2009
Manchmal wacht man morgens auf und weiß, dass alles nicht so ist, wie sonst. Es ist nicht ein etwaiger dicker Kopf von der vorabendlichen Feier, den ich meine, sondern die Textur der Luft, das Licht und überhaupt die ganze Wahrnehmung der Welt.
Heute Nacht hatte ich wieder einen besonders interessanten, weil intensiven Traum. Wieder habe ich alle Gesichter gesehen, Gespräche geführt, interagiert und kann mich noch an alles erinnern:
Wir sammelten uns auf einem der Hügel vor der Stadt. Das Wetter war heiß, die Sonne brannte auf die Dächer der einstöckigen Häuser unter uns. Ein warmer Wind wehte Sand durch die Straßen. Nur wenige Menschen waren unterwegs und wenn, dann schnell, um wieder im Schatten zu verschwinden. Hier oben gab es Bäume, unter deren Blätterdach es etwas kühler war, dazu war das Gras noch nass vom Tau. Die Szenerie im Tal ähnelte einer Westernstadt in der Wüste. Wir waren sechs oder acht Leute, Männer und Frauen, alle in normaler moderner Kleidung. Ich musste wohl ihr Anführer sein, denn sie liefen mir immerzu hinterher, das kann aber auch daran liegen, dass ich den Zettel in der Hand hielt. Darauf war eine Karte der Stadt und eingetragen darin zwei Stellen, markiert mit X.
Ich ging voraus zur ersten Stelle, das war noch am Stadtrand und dort fanden wir eine Meute von Menschen, die ein Gewirr aus Stangen ansah. Das Konstrukt war etwa mannshoch und die Rohre fingerdick. Ein junger Mann aus meiner Gruppe trat an mich heran und flüsterte mir zu, dass das hier eine Aufgabe wäre und wir müssten sie möglichst vor den anderen lösen. Ich drängte mich vor, man ließ mir Platz und mit ein paar Handgriffen steckte ich das Puzzle so zusammen, dass man, wenn man ein paar Schritte zurücktrat, ein Wort daraus erkennen konnte.In dem Moment, als ich fertig war, trat aus dem Pulk, der uns umringte, ein großer Mann heraus, warf die Stangen um und griff mich mit bloßen Händen und wütendem Ausdruck in den Augen an. Man machte uns noch mehr Platz. Alles war erstaunlich leise, als würde schon bekannt sein, was gerade passierte. Mein Gegner war einen Kopf größer als ich, aber nicht viel stärker. Als er versuchte, mir mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, nahm ich sein Handgelenk, drehte es herum und schleuderte ihn wie einen Kartoffelsack auf den Boden, in den aufwirbelnden Staub der Straße. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht, denn meine Gruppe war schon wieder unterwegs zur zweiten eingezeichneten Stelle meiner Karte.
Die Sonne begann, hinter dem Horizont unterzugehen, als wir ein Haus am anderen Ende der Stadt erreichten. Obwohl die Ansiedlung von oben nicht groß ausgesehen hatte, waren wir anscheinend eine Zeitlang unterwegs gewesen, denn alle waren staubverschmiert, müde und erschöpft. Das Haus war ganz aus dunklen Holzbrettern gezimmert, mit einer Veranda, über die man in ein dunkles Zimmer treten konnte. Auch hier drin war ein ähnliches Gewirr aus Stangen, das aussah wie moderne Kunst, uns aber auch hier wieder eine Aufgabe stellte. Diesmal versuchten es erst mal die anderen irgendwie zusammen zu setzen, aber das schien nicht zu funktionieren.
Ich setzte mich auf einen der Stühle in einer Ecke und verschnaufte. Links und rechts von mir saßen zwei junge, südländisch wirkende Männer, ein wenig kleiner als ich, die mit sorgenvoller Miene irgendetwas murmelten. Als alle aufgegeben hatten, das neue Puzzle zu lösen, stand ich auf und sah es mir aus der Nähe an. Warum ich eine Eingebung hatte, weiß ich nicht, aber ich wusste, was zu tun war: Ich nahm das ganze Gebilde auf einmal, hob es an und stellte es zur Seite. Darunter lag eine zerbrochene Schieferplatte, auf deren Rückseite ein Wort zu lesen war: wehlen.
Es war wieder am nächsten Morgen, als wir das Zimmer verließen. Auf dem großen runden Platz vor dem Haus stand eine Ansammlung von Mongolen in traditioneller Kleidung, also Deel, Hut und Stiefel, alle bewaffnet bis unter die Zähne. Einer von ihnen, klein aber stämmig, trat vor und zog ein großes, glänzendes, überhaupt nicht mongolisches Schwert und teilte mir mit, dass ich gegen ihn kämpfen müsse, was seine Horde grunzend quittierte. Meine Leute stöhnten vor Furcht auf und ich selber hatte auch kein gutes Gefühl dabei.
Den restlichen Tag verbrachten wir damit, uns auf den Kampf vorzubereiten. Zuerst durfte ich mir aus dem reichhaltigen Fundus der Mongolen eine Waffe aussuchen und wählte einen kleinen, stabilen Wurfspeer, den man auch zum Stoß verwenden könnte. Dann zeigte man mir die zwei Pferde, von denen wir Kämpfer je eines auswählen durften. Eines war ruhig und sicher und eines wild und schnell. Meine Gefährten beschworen mich, doch ja das ruhige zu nehmen, denn dann würde es nicht mit mir durchgehen. Ich aber lachte sie aus und erklärte, dass ich sehr wohl auch mit dem Wilden umgehen kann, ich sei ein erfahrener Reiter und mir wäre es lieber, wenn mein Gegner das langsame hätte. Dann übte ich mit dem Speer, indem ich Teststöße auf einen Holzpflock machte. Immer und immer wieder stieß ich zu, bis plötzlich die Spitze zerbröselte. Ich sah mir die Waffe genauer an und stellte fest, dass sie ausgesprochen morsch war. Langsam stieg Panik in mir auf, denn wie sollte ich unter den Umständen gewinnen können?
Unsere Vorbereitungen wurden durch ein unvorhergesehenes Ereignis unterbrochen. Aus der Ferne hörten wir laute Schreie und wildes Gepolter. Ich sah um eine Häuserecke, und erkannte eine führerlose Kutsche direkt auf uns zukommen. Ohne zu zögern trat ich vor und streckte die Hand aus. Das Pferd wurde langsamer, kam heran und ich konnte es am Zaumzeug greifen. Der Kutscher, ein dickes schwitzendes Männlein, das vollkommen außer Atem hinterhergerannt kam, nahm die Zügel wieder an sich und dankte mir vielmals. Ich winkte ab, weil ich echt anderes im Kopf hatte, schließlich würde ich demnächst höchstwahrscheinlich im Kampf fallen.
Wieder zurück auf der Veranda des Hauses, in dem wir das Schild gefunden hatten, saßen wir und warteten auf den Beginn des Duells. Anders als erwartet, kamen aus der Ferne aber keine mongolischen Reiter, sondern Ritter in bunten Gambesons auf Pferden heran, die sich vor uns aufbauten und mir für die Aktion mit der Kutsche überschwänglich dankten, im Namen der Acht (ich zählte – es waren acht Ritter) und sich dann sogar vor mir gemeinsam verbeugten. Ehe ich sie fragen konnte, ob sie statt des Dankes nicht einen Ausweg aus meiner Misere hätten, klingelte es.
Meine Frau hatte den Alarm ihres Mobiltelefons versehentlich eine Stunde zu früh eingestellt. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber ärgern soll, oder ob sie mir das Leben gerettet hat. Auf jeden Fall war der Traum erst mal vorbei.
So begann er, der heutige Tag.
Irgendwas ist anders als sonst. Ich habe ein Kribbeln in der linken Hand und die Härchen stehen auf dem Handrücken zu Berge, schon die ganze Zeit. Dabei geht es mir sonst gut, obwohl mir auffällt, dass die anderen Menschen, denen ich begegne, auch alle irgendetwas Seltsames zu berichten haben, krank oder launisch sind. Und es häufen sich kleine, aber feine Ausfälle an den Maschinen, die ich betreue.
Es liegt entweder an mir oder der Welt, vielleicht an beidem. Aus Erfahrung mit vergleichbaren Tagen in der Vergangenheit weiß ich, dass sich das wieder normalisiert. Seltsam ist es aber schon.
Irgendetwas ist anders.